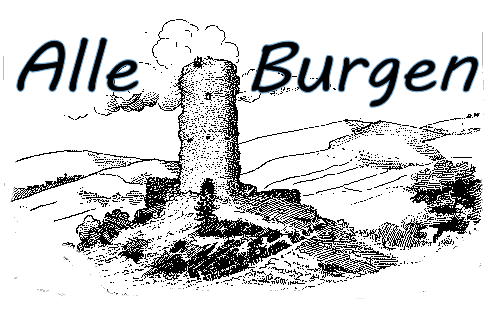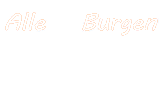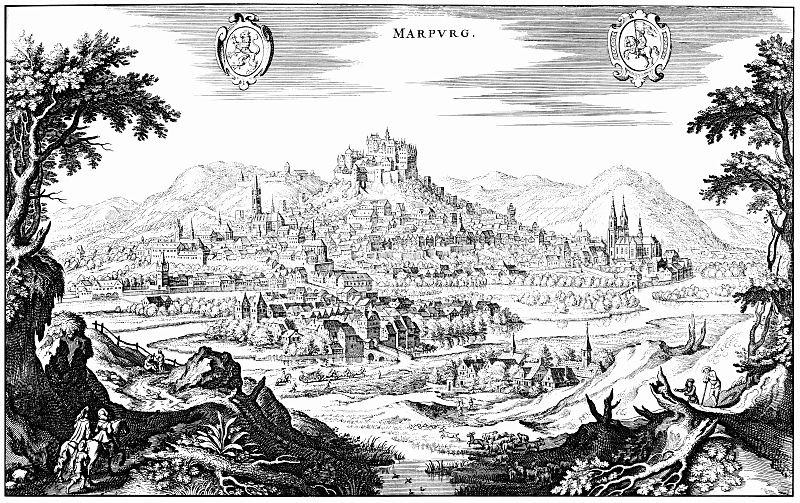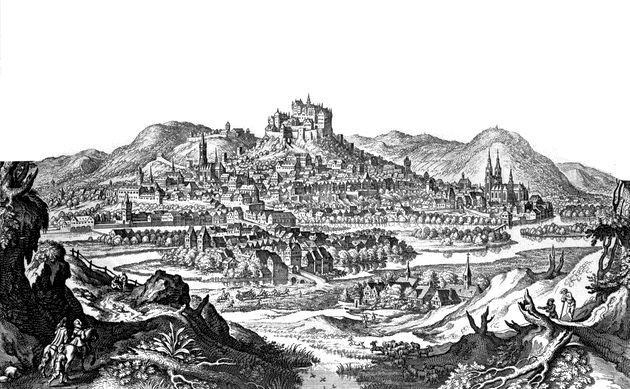Alternativname(n)
Landgrafenschloss
Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Hessen |
| Bezirk: | Giessen |
| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf |
| Ort: | 35037 Marburg an der Lahn |
| Adresse: | Schloss 1 |
| Lage: | auf einem 287 m hohen Bergsporn über der Altstadt |
| Geographische Lage: | 50.809996°, 8.766998° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Hufeisenförmige Doppelschlossanlage mit Renaissanceanbauten und vorgelagerten Befestigungsanlagen
Bei Ausgrabungen unter dem Westflügel (1989/90) wurden Mauerreste entdeckt, die man in ihrer Entstehungszeit auf spätes 9., eher spätes 10./frühes 11. Jahrhundert schätzt. Das Marburger Schloss gehört auf jeden Fall zu den frühesten Höhenburgen in Deutschland; die Erbauer bleiben unbekannt.
Bei Ausgrabungen unter dem Westflügel (1989/90) wurden Mauerreste entdeckt, die man in ihrer Entstehungszeit auf spätes 9., eher spätes 10./frühes 11. Jahrhundert schätzt. Das Marburger Schloss gehört auf jeden Fall zu den frühesten Höhenburgen in Deutschland; die Erbauer bleiben unbekannt.
Maße
| Fürstensaal im Nordflügel 33 x 14 m (größter gotischer Profanraum in Deutschland) |
Kapelle
Patrozinium: St. Katharina
Schlosskapelle am östlichen Ende des Hochschlosses, 1288 der heiligen Katharina geweiht
Schlosskapelle am östlichen Ende des Hochschlosses, 1288 der heiligen Katharina geweiht
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Gisonen | als Erbauer |
|---|---|
| Landgrafen von Thüringen | 1122 |
| Landgrafen von Hessen | |
| Marburger Philippsuniversität | 1946 |
Historie
| um 900 | erbaut |
|---|---|
| 1138/39 | („Mareburg“) |
| ab 1122 | Ausbau der Burg durch die Landgrafen von Thüringen |
| um 1200 | Ausbau der Burg zur thüringischen Nebenresidenz |
| ab 1248 | Ausbau der Burg zum Fürstenschloss und zur Festung |
| ab 1260 | Errichtung des Landgrafenbaus |
| ab 1292 | Errichtung des Fürstenbaus für Heinrich I. |
| 1493–1497 | Errichtung des Wilhelmsbaus |
| 1572 | Bau der Rentkammer durch Ludwig IV. von Hessen |
| 1604 | Ende der Nutzung als Hauptresidenz mit dem Tod von Landgraf Ludwig IV. |
| 1618/48 | im Dreißigjährigen Krieg mehrmals belagert und geplündert |
| ab 1624 | Errichtung von Kasematten auf der westlichen Vorburg |
| 1700–1740 | Ausbau zur Festung |
| 1756/63 | mehrmalige Eroberung der Festung im Siebenjährigen Krieg |
| bis 1807 | Sprengung der Festungsanlagen |
| 1815–1869 | Nutzung als Gefängnis |
| 1870–1938 | Nutzung als Preußisches Staatsarchiv |
| 1977–1990 | saniert |
| 1981 | Eröffnung des Musuems für Kulturgeschichte im Wilhelmsbau |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Dursthoff, Lutz (Redaktion): Die deutschen Burgen und Schlösser in Farbe, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-8105-0228-6 |
| Elmar, Brohl: Festungen in Hessen. Deutsche Festungen 2, Regensburg 2013 |
| Großmann, Dieter: Das Schloss zu Marburg an der Lahn. Große Baudenkmäler 366, München 1985 |
| Großmann, Ulrich G., Wartburg-Gesellschaft (Hrsg.): Schloss Marburg. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa 3, 2. Aufl., Regensburg 2007 |
| Meiborg, Christa, hessenARCHÄOLOGIE des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (Hrsg.): Das Marburger Landgrafenschloss im Spiegel der Archäologie. Archäologische Denkmäler in Hessen 179, Wiesbaden 2021 |
| Meiborg, Christa: Suche nach dem Gisonenfels - Grabungen im Marburger Schloss, in: Zeitschrift „Archäologie in Deutschland” Heft 4/1991, S. 6-11, Stuttgart 1991 |